„Ich hab damals geschuftet und nicht schlecht gelebt, und heute schufte ich und lebe nicht schlecht“, sagt David Davidowitsch Gebel. Der 56-Jährige, ein Schrank von einem Mann, aber ein gut gelaunter, lenkt seinen weißen Kleinbus russischer Produktion über die dunklen Feldwege unter dem weiten, blauen Himmel Sibiriens. Auf seinen Feldern, hier 100 Hektar, dort 200, sprießen gerade die ersten Pflänzchen: Weizen, Gerste, Linsen. Gebel ist nicht unbedingt ein Philosoph. Aber dieser Satz ist sein Lebensmotto. „Schaffe, schaffe, Häusle baue“, heißt das heute in der Gegend Deutschlands, aus der Gebels Vorfahren vor knapp drei Jahrhunderten weit nach Osten zogen. Gebel selbst spricht eine altmodische Variante des Schwäbischen mit russischen Einsprengseln. Wenn es komplizierter wird, wechselt er ins Russische.
Sein Satz über das Schuften war die Antwort auf meine Frage, ob er der Sowjetzeit nachtrauert, immerhin fast die Hälfte seines Lebens, als er in der mächtigen Kolchose arbeitete, zuständig dafür, war dass die 56 Lastwagen fahrtüchtig blieben. „Alle Zeit muss mer schaun“, fügt er hinzu. „Selle Zeit konnt i net träume, was i jetzt hob“, sagt er.


„Selle Zeit konnt i net träume, was i jetzt hob.“
Jetzt lenkt er den Wagen durchs Dorf Rosental, biegt am ehemaligen Haus seiner Eltern ab und hält auf der Wiese dahinter. Hier stehen seine Traktoren, Eggen, Spritzen, gerade hat er sich einen neuen russischen Mähdrescher gekauft. Damit bestellt er seine Felder, 1100 Hektar Land, fruchtbare Schwarzerde bis zum Horizont. Aber dieses Gebiet an der Grenze zu Kasachstan hat seine Tücken: Wegen des langen Winters kann erst im Mai gesät werden, und es regnet nur ein Drittel so viel wie in Deutschland. Alle paar Jahre verdorrt das Getreide auf dem Feld. In der neuen Zeit kann man schnell alles verlieren.
Es hat eine Weile gedauert, bis er aus „seller Zeit“ in der heutigen angekommen ist, bis aus dem sowjetischen Mechanik-Ingenieur David Davidowitsch, der in der Kolchose arbeitete, ein selbstständiger Bauer geworden ist, mit vier Angestellten und einem eigenen Maschinenpark. Und hätte er eine Entscheidung anders getroffen, würde er heute wohl in Berlin-Marzahn, Detmold oder Augsburg wohnen.
Diese Weile war in Rosental, Alexandrowka, Blumenfeld, und wie sie alle heißen, die deutschen Kolonistendörfer im Gebiet Omsk, eine Zeit großer Hoffnungen und großer Enttäuschungen, eine Zeit, die Familien auseinandergerissen und neu zusammengewürfelt hat.
Die Frage „bleiben und durchhalten oder aufgeben und gehen“ riss tausende Familien auseinander.
Anfang der 90er Jahre wurde hier für einen Moment der große Traum vieler Russlanddeutscher wahr, die nach Hitlers Überfall auf die Sowjetunion von der Wolga nach Sibirien und Kasachstan verbannt worden waren: Im Süden des Omsker Gebietes, wo seit dem 19. Jahrhundert Deutsche siedelten, wurde der „deutsche Nationalkreis Asowo“ geschaffen. Würde die erfolgreiche Geschichte der deutschen Siedler aus Süddeutschland, die einst von Katharina der Großen eingeladen wurden, die über zwei Jahrhunderte relativ unbehelligt schafften und Häusle bauten, aber dann unter Stalin buchstäblich zerschlagen wurden, hier fortgeschrieben werden?
Hunderte deutscher Familien zogen aus Kasachstan über die Grenze ins Omsker Gebiet, um neu anzufangen. Aber die Sterne standen schlecht. Denn Russland versank im Chaos der 90er Jahre.
Unter den Russlanddeutschen gab es damals zwei Fraktionen: Die einen träumten von einem Wiederaufbau des Siedlungsgebietes, die anderen wollten so schnell wie möglich nach Deutschland. Und mit jedem weiteren Jahr des wirtschaftlichen Niedergangs, mit jeder Familie, die ihre Sachen packte und in den Zug nach Berlin stieg, wurde der Sog stärker. Die Welle schwoll an, bis sie Mitte der 90er mit hunderttausenden Ausreisen pro Jahr ihren Höhepunkt erreichte.
Die Frage „bleiben und durchhalten oder aufgeben und gehen“ riss tausende Familien auseinander. Gebel hat zu Hause einen Schuhkarton, aus dem er Bilder aus jener Zeit zieht: Da sitzen seine Schwestern mit ihren Familien in karg eingerichteten Küchen in Deutschland, auf dem Tisch Faber-Sekt, billiger deutscher Wodka, gut sichtbar an der Wand aufgestellt eine Packung Pralinen „Edle Tropfen.“ So kamen sie damals an.
Seine vier Schwestern gingen nach Deutschland, nur er und sein Bruder blieben. Auch seine Frau zog 1997 mit den zwei Kindern nach Deutschland. Er fuhr ein paarmal zu Besuch, aber dann entschied er, dass er hierher gehörte. Was sollte er auch mit dem, was er gelernt hatte, mit diesem schwäbischen Dialekt, den man nur in Blumenfeld richtig versteht, in Deutschland anfangen? Viele Russlanddeutsche seiner Generation arrangierten sich mit dem Leben in Deutschland, erfolgreich wurden erst ihre Kinder. Aber man sagte sich: Die Kinder sollen es mal besser haben.
Gebel blieb. Und heiratete Mascha, die nach einem Jahr in Deutschland mit ihrer Tochter Kristina zurückgekommen war. 1998, er arbeitete noch in der Kolchose, kaufte er seine ersten 100 Hektar Land, von einem Russlanddeutschen, der aufgegeben hatte. Kostenpunkt: ein russisches Auto, Marke Wolga. „Niemand wollte damals dieses Land“, sagt er.
1998, das war der Tiefpunkt der russischen Wirtschaft, ein letztes Mal wurde der Rubel massiv entwertet, ab da ging es langsam aufwärts. Auch für Gebel: 2001 verließ er die Kolchose, mit jedem Jahr kaufte er mehr Land und mehr Maschinen.
Aber gierig ist er nicht, und das ist sein Glück.
2008, da war er der größte Bauer der Region, sagte er sich: „Es reicht. Je mehr Land du hast, desto größer wird das Risiko.“ Mal regnet es zu wenig, mal ist die Ernte gut, aber der Preis schlecht. Von fünf Jahren ist nur eins wirklich gut. Im Dorf gibt es heute noch zwei andere Bauern seiner Größenordnung. Andere sind pleite gegangen, weil sie sich verrechnet haben.


Von den 2500 Bewohnern sind heute gut 600 Deutsche, 300 Kasachen, der Rest ist ein bunter sowjetischer Blumenstrauß aus Esten, Ukrainern und Usbeken.
Gebel, der hart gearbeitet und gut gerechnet hat, der investierte, was er verdiente, gehört zu den Gewinnern der letzten zwei Jahrzehnte. Zusammen mit seiner Frau Mascha, die als Buchhalterin im Dorfladen arbeitet, lebt er im Dorf Blumenfeld (das natürlich offiziell den russifizierten Namen Tswetnopolje trägt) und genießt, was er sich erarbeitet hat. Aber auch den anderen Menschen geht es grundsätzlich nicht schlecht. Die Häuser wirken nicht reich, aber gepflegt. Nur die paar wenigen Dorfstraßen bestehen aus mehr Loch als Asphalt.
Aber die Zusammensetzung der Bevölkerung hat sich in den letzten zwanzig Jahren massiv verändert. Waren damals die meisten „deitsche Leit“, wie es hier heißt, bilden heute Russen die größte Gruppe. Sie kamen aus dem nahen Kasachstan, wo nach dem Ende der Sowjetunion das Verhältnis zwischen Russen und Kasachen angespannt war, und zogen in die Häuser der Deutschen, die das Weite gesucht hatten. Von den 2500 Bewohnern sind heute gut 600 Deutsche, 300 Kasachen, der Rest ist ein bunter sowjetischer Blumenstrauß aus Esten, Ukrainern und Usbeken. Arbeit gibt es in der Landwirtschaft, als Lehrer, im Krankenhaus, der Lohn ist niedrig, aber dazu halten sich die Menschen ein paar Schweine, Kühe und Hühner, einen großen Gemüsegarten hat ohnehin jeder. „G‘hungert hat im Dorf nie jemand“, sagt David Davidowitsch.
Unter den heutigen Bewohnern sind auch eine Handvoll „deitsche Leit“, die zurückgekommen sind aus dem gelobten Land, die es noch einmal hier probieren wollen. Und immer mehr wollen zumindest mal schauen, wie es aussieht in der alten Heimat. Eine von Gebels Schwestern kam nach 21 Jahren zum ersten Mal wieder: „Und sie konnt‘s gar nit glauben, wie‘s jetz hier is“, erzählt Gebel. Man merkt ihm die Freude darüber an, dass er es geschafft hat, dass sich das Durchhalten und Ackern, das Festhalten an der Heimat, am Ende gelohnt hat.
Ein Russlanddeutscher hat am Rand von Blumenfeld vor ein paar Jahren eine Straußenfarm eröffnet, ein anderer eine erfolgreiche Brauerei im Städtchen Asowo. Ein anderer Rückkehrer, ein Freund von Gebel, hat seine Seelenlage so erklärt: „Wenn ich in Deutschland bin, zieht‘s mich hierher. Aber wenn ich hier bin, zieht‘s mich nicht nach Deutschland.“ Knapp 400.000 Deutsche lebten 2010 noch in Russland, 50.000 davon im Gebiet Omsk. Gibt es vielleicht doch eine Zukunft für die Deutschen von Omsk?
„In Deutschland ist es vielleicht einfacher, aber ich will hier was machen.“
Die Zukunft der Deutschen könnte so aussehen wie Kristina, Gebels Tochter: Die 24-Jährige, rötliche Locken, gewinnendes Lächeln, spricht neben dem schwäbischen Dialekt schönstes Hochdeutsch. Während die Eltern und Großeltern nur zu Hause „deitsch“ sprachen, hat sie Germanistik studiert. Kristina besitzt einen deutschen Pass, und wenn sie wollte, könnte sie jederzeit ihren Koffer packen und aussiedeln – aber sie will hierbleiben, am liebsten in Blumenfeld, nicht in der Millionenstadt Omsk. „In Deutschland ist es vielleicht einfacher, aber ich will hier was machen“, sagt sie. Kristina nennt sich eine Patriotin: Im Urlaub fährt sie nicht nach Ägypten oder in die Türkei, sondern ins Altaigebirge oder an den Baikalsee.
Jedes Wochenende holt der Vater sie ab in Omsk und bringt sie 80 Kilometer nach Hause in die Dorfidylle. Da packt Kristina dann mit an im Gemüsegarten, genießt das gute Essen im Dorf, schaut sich den Sonnenuntergang auf den Feldern draußen hinter den letzten Häusern an.
Und sie trifft sich mit den ehemaligen Klassenkameraden, die aber auch nur am Wochenende nach Hause kommen. Heute Abend ist Dorffest auf einer Lichtung am Ortsrand. Es duftet nach Schaschlik, russische Popmusik schallt über die Wiese, die angetrunkene Dorfjugend hat ihren Spaß. Kristina grüßt hier jemand, da jemand. Aber sie wirkt auch etwas verloren unter diesen Leuten. Ist sie schon eine Städterin geworden?
Der Vater hat ihr in den letzten Jahren mit dem Ersparten sogar ein eigenes Haus gebaut, das so auch in einem deutschen Dorf stehen könnte. Das einzige Problem für Kristina: „Was soll ich hier machen?“ Sie würde gerne als Lehrerin arbeiten, aber das Gehalt liegt bei umgerechnet 200 Euro. In Omsk, wo sie im Deutsch-Russischen Haus arbeitet, bekommt sie immerhin das doppelte. Hier wohnen und jeden Tag ein bis zwei Stunden über die holprige Piste nach Omsk zur Arbeit fahren? Auch das keine Variante.
Der Vater hat ihr da eine Idee eingeflüstert: Agrotourismus für die „deitschen Leit“, die keine Verwandten mehr haben im Ort, aber die ihre Sehnsucht nach der einstigen Heimat immer öfter ins Gebiet Omsk treibt. Vielleicht ist ja unter ihnen ein „Deitscher“, dem seine sibirischen Wurzeln wichtiger sind als das einfache Leben dort. Der es in Blumenfeld noch einmal versuchen will.



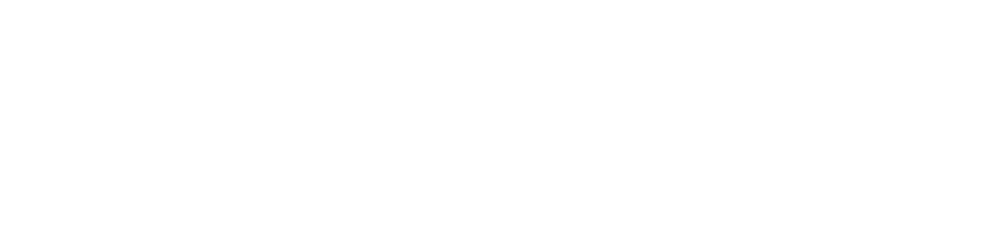

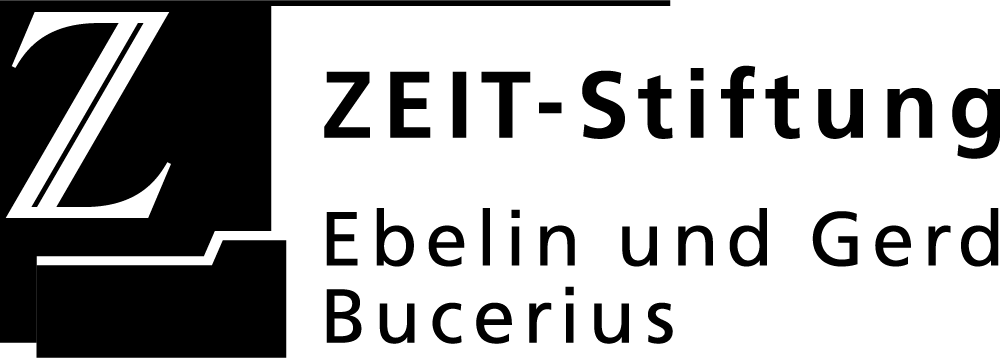
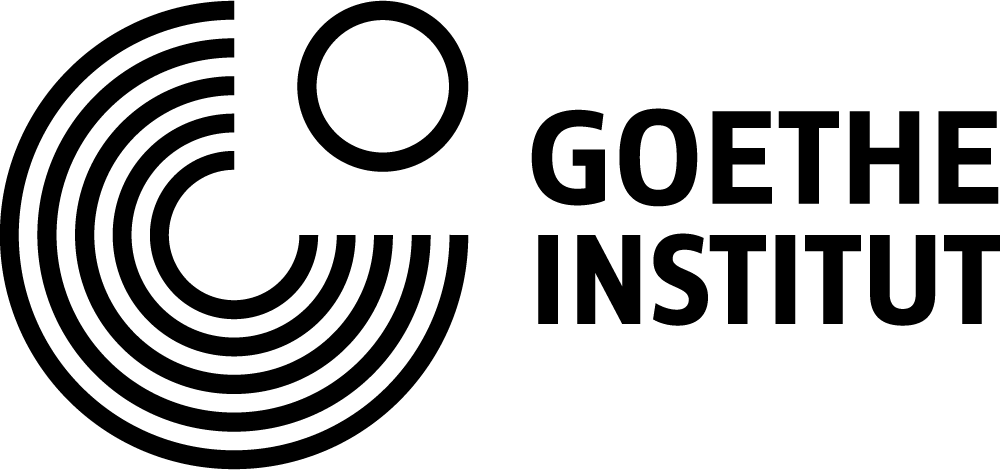
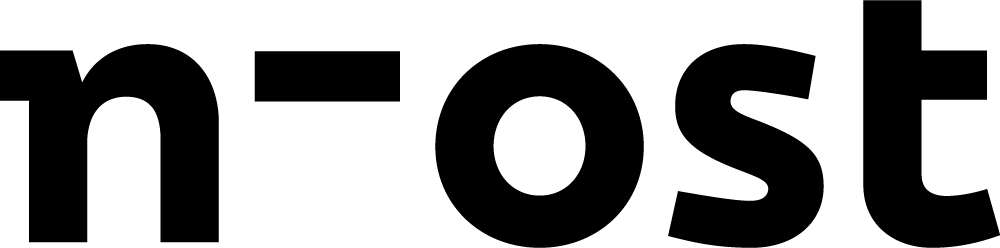
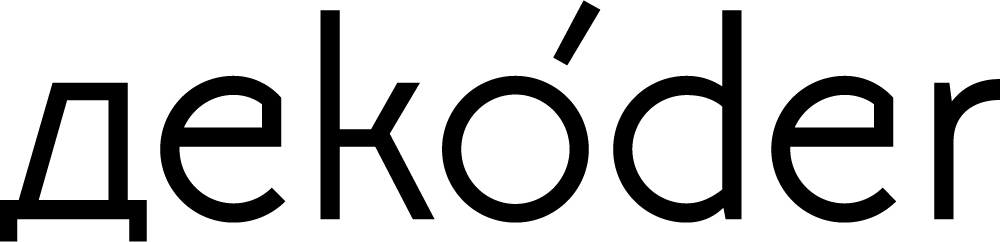

























































Mir tue auch immer noch birok un krebel esse do in argentinien wo mir schon seit über hundert jahr aus russland aussgesiedelt sind. Grüsse an alle landsgenosse.
Comments are closed.