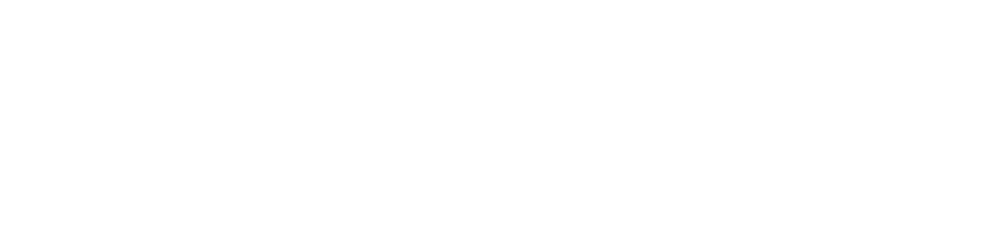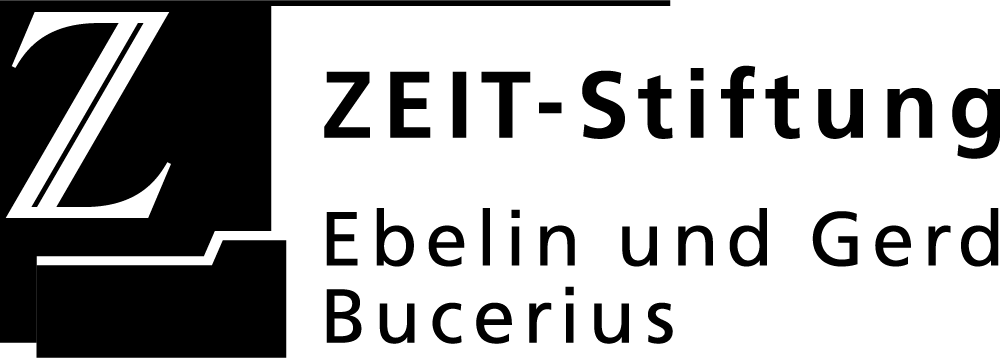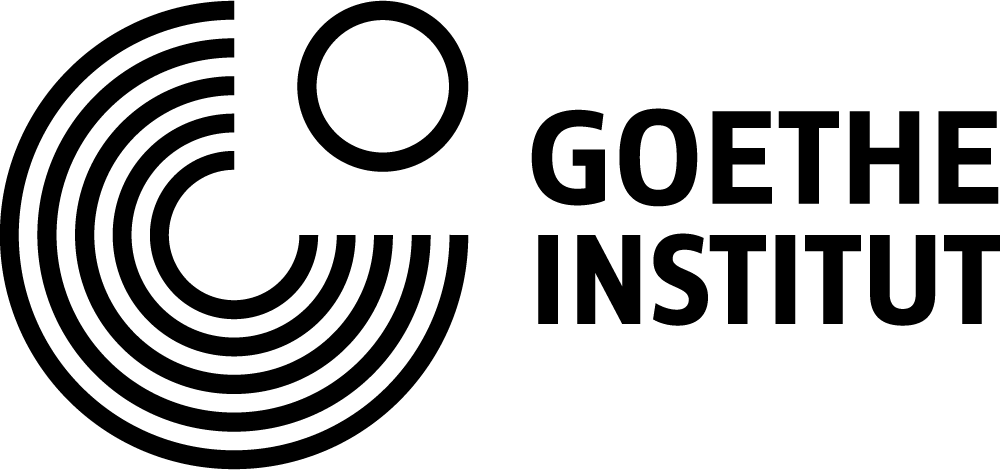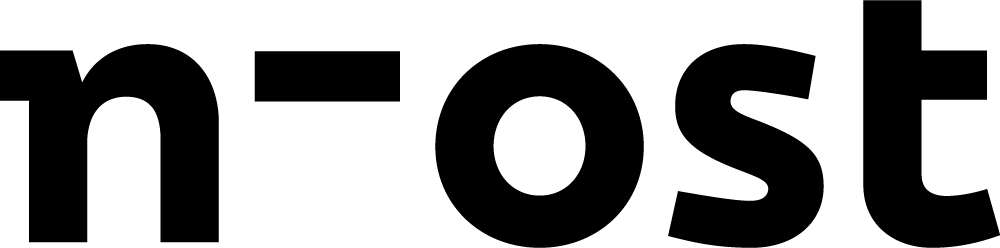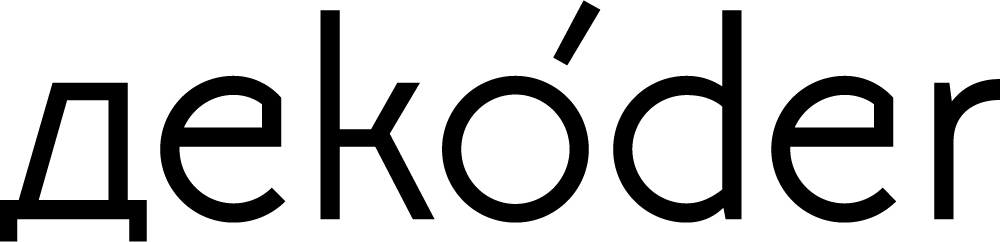Jurij Michailowitsch denkt nicht lange nach, als ich ihn nach den Sanktionen frage. „Danke, danke an Angela Merkel. Bitte noch mehr davon!“ antwortet der Bauer verschmitzt und schüttelt mir mit demonstrativer Dankbarkeit die Hände.
Jurij Michailowitsch ist Herr über mehrere tausend Ziegen, 4000 Hektar Land und 100 Traktoristen und Melkerinnen nahe dem Städtchen Sernur, 200 Kilometer nördlich von Kasan.
Seit 2014 läuft es hier richtig gut, seit Russland als Antwort auf die westlichen Sanktionen die Einfuhr vieler Lebensmittel aus den westlichen Ländern und ganz explizit den Import von Milchprodukten verboten hat.
Insgesamt 8000 Ziegen liefern dem Konzern „Lukoz“ Milch, allein in den letzten zwei Jahren sind 1500 hinzugekommen. Von hier wird die Milch mit Tankwagen rübergefahren in die Käserei des Konzerns am anderen Ende des Städtchens Sernur.


Joghurt haben sie von Israel gelernt, Ricotta von den Italienern, Camembert von den Franzosen, Halloumi von einer Firma aus Zypern.
Über die Produktion von Käse, Quark und Milch wacht Albert Sibagatullin, ein junger Tatare aus Joschkar-Ola, Hauptstadt der Republik Mari El. Er erzählt, wie seine Lebensmitteltechnologen in den letzten Jahren dazugelernt haben: „Joghurt haben wir von Israel gelernt, Ricotta von den Italienern, Camembert von den Franzosen, Halloumi von einer Firma aus Zypern.“ Mal lädt die Käserei Spezialisten aus den Ländern ein, mal fahren die Lebensmitteltechnologen selber zu Lehrgängen dorthin. So ist in den letzten vier Jahren die Zahl der Käsearten, die produziert werden, auf 60 gewachsen. Und die Anzahl der Mitarbeiter allein in der Produktion von 150 auf 300.
Sibagatullin führt uns durch die Käserei. Überall stehen neue Maschinen und Behälter, die die Firma in den letzten Jahren gekauft hat. Die Pasteurisierungsanlage ist komplett neu. Es riecht heftig nach Ziegenmilch. Dabei sind 90 Prozent der 3000 Tonnen Milch, die Lukoz pro Monat verarbeitet, Kuhmilch, die der Konzern einkaufen muss.

Doch der Käse aus Sernur hat seinen Preis: Für den ein Jahr gelagerten Hartkäse „Marsental Tourné“ muss der Verbraucher über 30 Euro pro Kilo auf den Tisch legen.
Die Käsesorten, die man uns zum Probieren gibt, schmecken köstlich. Zwar produziert Lukoz auch weiterhin klassische russische Käsesorten wie den eher charakterlosen und günstigen „Rossijskij“, aber profitabel sind die Sorten, nach denen die Russen „Hunger“ verspüren, wie Sibagatullin sagt.
Insbesondere in den russischen Großstädten gehörten Emmentaler, Camembert und Mozzarella 2014 schon fest zum Speiseplan der Mittel- und Oberschicht. Aber seitdem gibt es nur noch teuren Schweizer Käse – die Schweiz hält sich bei den Sanktionen raus. Im ganzen Land versuchen seitdem Käsereien, die beliebten europäischen Käsesorten nachzuahmen. Dabei entstehen auch billige Plagiate, etwa Parmesan, der nur von außen Ähnlichkeit mit dem italienischen Original hat.
Nicht so in Sernur. Doch die Produktion der Käsemacher hat ihren Preis: Für den ein Jahr gelagerten Hartkäse „Marsental Tourné“ (der Name ist eine Eigenschöpfung) etwa muss der Verbraucher über 30 Euro pro Kilo auf den Tisch legen. Das kann sich vor allem die obere Mittelschicht in Moskau, St. Petersburg oder Kasan leisten, wo der Käse aus Sernur in den Käsetheken liegt und per Internetshop verkauft wird. Aber auch der Halloumikäse von Lukoz und die Butter kosten mehr als in einem deutschen Supermarkt.
Das hängt vor allem mit den hohen Milchpreisen in Russland zusammen: Das Land produziert noch immer zu wenig Milch, und insbesondere qualitativ hochwertige Milch, die für die Käseproduktion notwendig ist, ist teuer. Der Preis liegt mit derzeit 34 Cent über dem Preis für einen Liter Milch in Deutschland.
Aber auch der Fachkräftemangel macht der Firma zu schaffen, wie Sibagatullin erzählt: Eine Melkerin oder einen Lagerarbeiter kann man im 10.000-Seelen-Städtchen Sernur noch finden – aber eben keine studierten Lebensmitteltechnologen. Er und die meisten anderen Fachkräfte fahren deshalb jeden Tag die etwa 100 Kilometer aus Joschkar-Ola nach Sernur.
Am Nachmittag treffen wir den Besitzer des Konzerns: Wladimir Tarasewitsch Koschanow, ein anfangs etwas mürrischer Russe, der gerade gestern seinen 67. Geburtstag gefeiert hat. 2003 übernahm er den Betrieb in Sernur, damals eine völlig heruntergewirtschaftete Kolchose, die drei Sorten Käse produzierte. Für einen 67-jährigen Russen sieht Koschanow ungewöhnlich gut aus. Auch seine Worte sind überraschend.
Er beginnt mit einer Wutrede gegen die industrialisierte Landwirtschaft. „Bei euch versucht man, aus zwei Kilo Getreide am Ende ein Kilo Fleisch zu bekommen“, beschwert er sich. „Die Tiere sind Fabriken, es zählt nur die Effektivität.“
Aber ist es nicht dasselbe in Russland? Gerade in den letzten Jahren wurden in Belgorod und sonstwo regelrechte Fleischfabriken errichtet. Seit Russland die Gegensanktionen erlassen hat, melden die Gouverneure alle paar Monate stolz, dass auch in ihrem Gebiet ein „Milchkomplex“ mit 5000 Kühen entstanden ist.
„Natürlich geht es erstmal darum, den Hunger zu stillen, dafür zu sorgen, dass es genügend billige Milch und billiges Fleisch gibt“, stimmt Koschanow zu.

Aber er zielt auf eine andere Nische: Seine 8000 Ziegen werden – ohne dass es dafür ein Siegel geben würde – weitgehend biologisch ernährt und das ganze Jahr über in offenen Ställen gehalten. Verantwortlich dafür ist der Oberbauer Jurij Michailowitsch. Der hat bis vor einigen Jahren noch den olympischen Nachwuchs in der Nachbarstadt Tscheboksary trainiert. „Von dort habe ich gelernt: Abhärtung ist das beste Mittel gegen Krankheiten“, sagt er. „Obwohl alle mir erzählt haben, dass die Ziegen es nicht kälter haben dürfen als 10 Grad Plus – die stehen auch bei minus 30 in den offenen Ställen, und es geht ihnen gut. Es kommt eben auf die Ernährung an!“ Auch seine Ernährungsphilosophie hat er von seinen Olympioniken: Die Tiere bekommen ein Granulat aus Hülsenfrüchten, Hafer, Gerste, Zucker, Salz und Calcium, dessen Inhaltsstoffe der Bauernhof zum großen Teil selbst produziert. Jurij Michailowitsch reicht uns zum Beweis ein paar Pellets zum Knabbern: „Hier, kann auch ein Mensch essen“.
"Es kommt nicht allein darauf an, so viel Wurst wie möglich zu essen."
„Wir können nicht das ganze Land ernähren, aber zumindest 100.000 Menschen. Unsere Nische sind hochwertige Lebensmittel, die positive Emotionen geben, wenn man sie isst“, sagt Koschanow. Der Satz klingt reichlich westlich und wie aus dem Reklameprospekt.
Natürlich denkt man hier darüber nach, was passieren wird, wenn einst die Sanktionen fallen und die Gegensanktionen aufgehoben werden, in fünf oder zehn Jahren. Dann wird das wohl die Nische sein, in der Firmen wie Lukoz überleben können.
Während diejenigen Russen,die es sich leisten konnten, in den fetten Nullerjahren alles kauften, was aus dem Westen kam, egal zu welchem Preis, wird nun mehr und mehr das Eigene geschätzt. In Moskau ist besonders die Bio-Kette „Lawka-Lawka“ erfolgreich, die ihre Nahrungsmittel von Kleinbauern aus der Umgebung bezieht.
Gegen die Billigvarianten von Camembert oder Emmentaler aus europäischer Industrieproduktion wird Lukoz keine Chance haben, das weiß auch Koschanow. Er glaubt, dass dafür auch die Bedingungen zu unterschiedlich sind: Hier in der Republik Mari El kommt der Frühling spät und der Winter früh, man kann nur einmal in der Saison Heu machen – in Europa dagegen dreimal. Seit Premierminister Medwedjew seinen Stand auf einer Agrarmesse in Moskau besucht hat, bekommen zwar auch Ziegenbauern wie er Subventionen, aber Koschanow will sich darauf nicht verlassen: „In diesem Jahr gibt es was, im nächsten vielleicht nicht mehr.“ Das Wichtigste ist: Die Qualität muss stimmen und konstant sein. Koschanows Sohn Taras ist deshalb gerade dabei, in der Käserei ein System zur Qualitätskontrolle einzuführen.
Am Nachmittag nimmt Koschanow uns noch in seinem Jeep mit zurück nach Joschkar-Ola. Wir machen einen Umweg über katastrophale Kleinstraßen in ein fast völlig verlassenes Dorf. Unser Ziel: eine heilige Quelle, die von einem halbverrückten Priester bewacht wird, der einem Dostojewskij-Roman entstiegen sein könnte. Koschanow steigt in das eiskalte Wasser, taucht dreimal unter. Ist er gläubig? „Schwach gläubig“, sagt er lachend. „Aber irgendwann habe ich verstanden, dass das Leben ohne Gott keinen Sinn macht. Es kommt nicht allein darauf an, so viel Wurst wie möglich zu essen.“