Kennt der ein oder andere das Albumcover von „Gulag Orkestar“? Wenn nicht – hier ist es. Der Sänger der amerikanischen World-Music-Band „Beirut“ fand das Bild einst ausgerissen aus einem Buch in einer Bücherei in Leipzig, hängte es an die Wand seiner Bude und nahm inspiriert davon sein Album auf. Schließlich landete es auf dem Plattencover.
Wer nie gefragt wurde, ob er damit einverstanden war, ist der Autor des Bildes – Sergej Tschilikow, eine lebende Legende der russischen Fotografie. Tschilikow, bärtig, lächelnd, wartet auf uns an einer Brücke einige Kilometer vor Joschkar-Ola, in Gummilatschen, zerrissenen Jeans und offener Tarnfarbenjacke, unter der sein prächtiger nackter Bauch zu sehen ist. Erster Eindruck: Tschilikow ist alles wurscht. Aber er freut sich über den Besuch.


Schräge Provinzvögel wie Tschilikow waren gern gesehene Gäste in dieser Glitzerwelt, auch wenn seine Renitenz gepaart mit Alkohol auch mal dazu führte, dass die Oligarchen ihn mit Handschellen an einen Stuhl fesseln ließen.
Ich war schon einmal zu Besuch bei Tschilikow, sieben Jahre ist es her. Da war gerade ein großer Bildband mit seinen Fotos beim Schweizer Verlag Benteli erschienen. Die Moskauer Kuratorin Olga Swiblowa hatte Tschilikow 2001 wiederentdeckt, brachte seine Bilder auf Ausstellungen in der ganzen Welt, nach Arles, Frankfurt und 2006 ins Guggenheim Museum in New York. 2008 wurden Bilderserien von ihm bei Sotheby’s verkauft.
Mein Besuch fiel schon auf das Ende dieses Jahrzehnts, in dem in Russland plötzlich wieder Geld und Interesse für Kunst da war. Vielleicht zu viel Geld. In Moskau entstanden mit Petrodollars von kunstinteressierten Oligarchen
Zentren für moderne Kunst wie Winzavod oder Garage, Swiblowa gründete 2001 das „Multimedia Art Museum Moskau“ (MAMM). Schräge Provinzvögel wie Tschilikow waren gern gesehene Gäste in dieser Glitzerwelt, auch wenn seine Renitenz gepaart mit Alkohol auch mal dazu führte, dass die Oligarchen ihn mit Handschellen an einen Stuhl fesseln ließen – so geschehen auf einem Ausflugsschiff auf dem Fluss Moskwa.
Aber diese fetten Jahre sind vorbei.
„Ich schaue mir diese ganzen Kataloge an – und es kommt mir heute so vor, als hätte das gar nichts mit mir zu tun“, sagt Tschilikow. Er sitzt mit einem Glas Rotwein auf seinem Bett, im Fernsehen läuft Belgien gegen Japan. Später wird die Glotze laufen, bis Tschilikow einschläft, grausame russische Talkshows, in denen über Merkels Niedergang und Trumps Treffen mit Putin gestritten wird.
Das letzte Mal hatten wir mit Tschilikow noch literweise Wodka getrunken, aber die Gesundheit des 65-Jährigen ist angeknackst, deshalb gibt es jetzt nur noch Rotwein für ihn. Seinen Humor hat der seebärige Tschilikow aber nicht verloren. Dafür aber die Lust an Ausstellungen. Nach London fliegen, Lobesreden anhören, Händeschütteln, Rumstehen, nee, das braucht er nicht mehr. Zumal er kaum etwas davon hat. Während der fetten Jahre nahm er in seinem Rucksack ein paar Kisten voller „Bildchen“ mit, wie er seine Fotokunst bescheiden nennt. Die stellte er auf einen Tisch, setzte sich daneben und verkaufte sie an jeden, der Interesse und Geld hatte.
Aber seit einigen Jahren kauft niemand mehr seine Bilder. In Russland hat das mit der Wirtschaftskrise zu tun, die auch die Kunst trifft. Im Ausland spielt Russland zwar politisch eine so große Rolle wie nie seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion – aber das Interesse an Fotokunst scheint eher übersichtlich zu sein.
"Hier in Joschkar-Ola schauten die Behörden nicht so genau hin - anders als in Moskau."
Als der 1953 geborene Tschilikow das erste Mal auf den Auslöser seiner Zenit-Kamera drückte, war das Tauwetter der 60er Jahre gerade vorbei. Was folgte, war die satte aber kulturell lähmende Breschnew-Ära. So fing der junge Philosophieprofessor Tschilikow in den 70ern mit Gleichgesinnten aus Joschkar-Ola und anderen Provinzstädten an der Wolga an, mit Fotografie zu experimentieren. Im Mittelpunkt stand, sich selbst zu analysieren, eine eigene Ausdrucksform zu finden und dieser dann treu zu bleiben. Das Geld verdiente er an der Uni, für die Kunst hatte er genug Freizeit.
An den Lebensverhältnissen änderte sich in den 80ern wenig – aber Leute wie Tschilikow schufen sich mehr Freiräume – gerade hier in der Provinz. Tschilikow gründete den Fotoclub „FAKT“ und organisierte Fotobiennalen, zu denen Fotografen aus der ganzen Sowjetunion nach Joschkar-Ola kamen. Warum in aller Welt nach Joschkar-Ola, damals womöglich noch mehr Provinz als heute? „Hier schauten die Behörden nicht so genau hin – anders als in Moskau“, erklärt uns Tschilikow.

"Das wichtiste an einem Bild ist, den künstlerischen Akt des Fotografen zu dokumentieren - alles andere ist utilitaristisch.“
Er und seine Mitstreiter setzten der klassischen Reportagefotografie, die sich auf die Fahnen schreib, das wahre Leben zu zeigen, und die in der Sowjetunion bis dahin dominierte, ihre demonstrativ inszenierten Fotografien entgegen. „Kunst ist der Ausdruck menschlichen Geistes. Das wichtiste an einem Bild ist, den künstlerischen Akt des Fotografen zu dokumentieren – alles andere ist utilitaristisch“, beschreibt Tschilikow seine Philosophie. Im Streit darüber verbringen wir einen langen Abend mit Christian, der in den 90ern an der Hochschule der Künste Berlin studiert hat, wo der Wind in der Fotografie gerade GEGEN die Idee der Inszenierung blies. In Tschilikows Serien mit Namen wie „Kuriose Begebenheiten“ oder „Abende auf dem Land“ sind dagegen Gegenstände wie Stühle, Uhren, Ofengabeln, Räder übereinandergestapelt. Irgendwann verstand Tschilikow, dass den Bildern die Menschen fehlten – seitdem organisierte er Menschen hinzu. Oft nackt, stehen und liegen sie zwischen den Dingen, klammern sich an Badewannen, Autos, Schlitten. Es war vielleicht die beste Zeit in Tschilikows Leben.
Als die Sowjetunion zusammenbrach, verließ Tschilikow stante pede die Universität, an der er bis dahin seinen Studenten den dialektischen Materialismus eintrichtern musste (und sie nebenher immer dazu aufforderte, ihren eigenen Kopf zu benutzen). In den ersten Jahren verdiente er noch ein paar schnelle Dollars mit Werbefotografie für die nun sprießenden privaten Firmen, die ihre Kühlschränke und Möbel an den Mann bringen mussten. Für Philosophen und Fotokünstler brachen jedoch harte Zeiten an. Tschilikow veröffentlichte 1993 noch sein 300 Seiten dickes künstlerisches Manifest „Der Besitzer des Dings oder die Ontologie der Subjektivität“, ließ 10.000 Exemplare drucken, von denen die meisten heute auf dem Speicher seiner Datscha vor sich hingammeln. Ansonsten kann er sich heute nicht mehr so recht erinnern, wovon er eigentlich gelebt hat in dieser Zeit.
Und er fotografierte weiter mit dem, was übrig blieb. Während andere Fotografen in den 90ern auf teure westliche Farbfilme und qualitativ hochwertiges Papier übergingen, bunkerte er das wertlos gewordene russische Fotomaterial und erzeugte mit einer speziellen Drucktechnik Bilder, deren „Schmutzigkeit noch die Schmutzigkeit des Gezeigten verstärkten“, wie er uns erklärt. Daraus entstanden die „Colorismen.“


In den fetten Nullerjahren dann wurde Tschilikow wiederentdeckt: Dutzende Kataloge aus aller Herren Länder aus dieser Zeit stapeln sich in seiner Stadtwohnung. Dann wurde es wieder still um ihn.
Vor zwei Jahren war Tschilikow nochmal mit der Kamera unterwegs, fotografierte eine Expedition auf einem Fluss in der Nachbarrepublik. Besser gesagt, „ich fotografierte das so, als wäre es ein Traum“, wie er sagt. Gerne würde man sehen, was herausgekommen ist. Aber die belichteten Filme liegen irgendwo in seiner Wohnung, Tschilikow hat das Interesse daran verloren.
Stattdessen war er den ganzen Winter über damit beschäftigt, das Holz, das er aus der Wildnis hinter seiner Datscha gezogen hat, zu hacken. Er hat den Ofen in seiner Banja neu gebaut.Und jeden Tag überarbeitet er eine Seite seines Traktas „Der Besitzer des Dings“. Die erweiterte Ausgabe soll 700 Seiten haben.


Sergejs Fotofreunde aus alten Zeiten kommen zu Besuch auf die Datscha, bringen einen Moskauer mit, der ganz aufgeregt ist, Tschilikow endlich mal persönlich kennenzulernen. Schon 1988 habe er seine Bilder gesehen, berichtet er Tschilikow aufgeregt und erzählt von seiner eigenen Arbeit – Theaterfotografie. „Sekundärfotografie“, bemerkt Tschilikow verächtlich. „Da ist ja schon alles für dich inszeniert.“ Jaja, schon wahr, gesteht der Moskauer kleinlaut ein. Tschilikow genießt auch in Badehose Autorität.
Mit den Fotografen, aber ohne Tschilikow, gehen wir spazieren, raus aus dem Tor der Datscha zum nahegelegenen Flüsschen Kundysch. Hier am Strand ist eines seiner schönsten Bilder enstanden. „Vor dem Sturm“ aus dem Zyklus „Alltag“: tiefdunkle Wolken am Himmel, eine Frau im gelben Kleid eilt vor dem Betrachter davon, halb eingegraben im Sand ein Eisenkarren.

Jetzt tobt die Dorfjugend wild durch‘s flache Wasser, unter den Brückenpfeilern saufen die älteren Jungs Bier und essen dazu gekochte Hühnerherzen. „Njet, nicht fotografieren“, rufen sie zu Anfang, aber dann fangen sie an zu posieren für den Fotografen, laufen fast über vor Virilität. Die Jungs lassen ihre Muskeln spielen und springen übermütig ins Wasser, die Mädels lächeln in die Kamera. Immer wieder habe ich mich gefragt, wie Sergej Tschilikow all diese einfachen Menschen auf seinen Bildern dazu gebracht hat, nackt, offen, frei für ihn zu posieren. Hier am Strand wird nach wenigen Minuten klar, wie einfach das geht in dieser Gegend.
Am letzten Tag verabschieden wir uns von Sergej in seiner Wohnung in Joschkar-Ola. Im Bücherschrank stauben die gesammelten Werke von Aristoteles, Locke und Kant vor sich hin, Tschilikows Bilderserien aus vier Jahrzehnten liegen wie Kraut und Rüben in Kisten über die Zimmer der Wohnung verteilt. „Da bräuchte ich mal irgendeine Motivation, um das alles in Ordnung zu bringen“, sagt Tschilikow nachdenklich. Christian schaut sich eine Bilderserie an, fragt, ob er eines der Bilder kaufen kann. „Naja, das ist eigentlich nicht üblich, dass man einzelne Bilder aus den Serien rausnimmt“, sagt Sergej. Das ist gut zu hören. Ganz egal ist ihm sein Werk also doch nicht.
Mehr von Sergej Tschilikow hier.
Sergey Chilikov, Werke 1978-, 192 Seiten, erschienen bei Benteli, 2011.



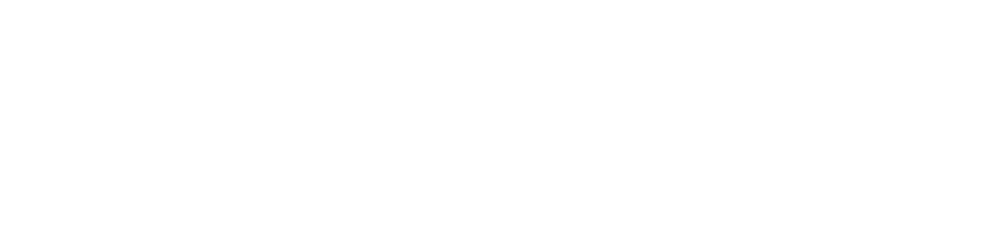

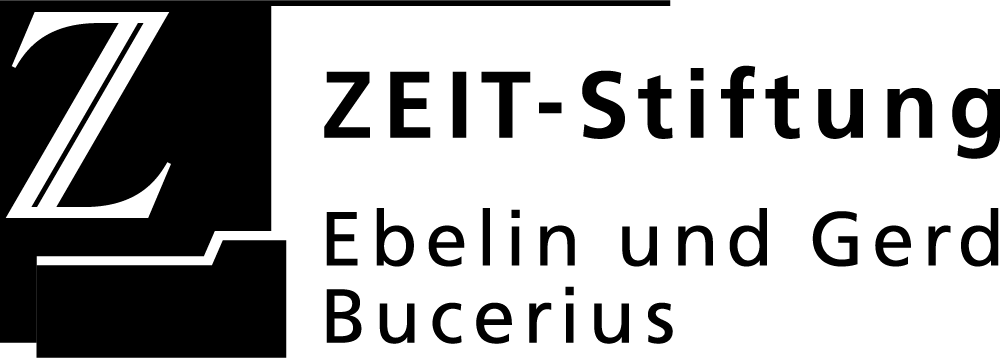
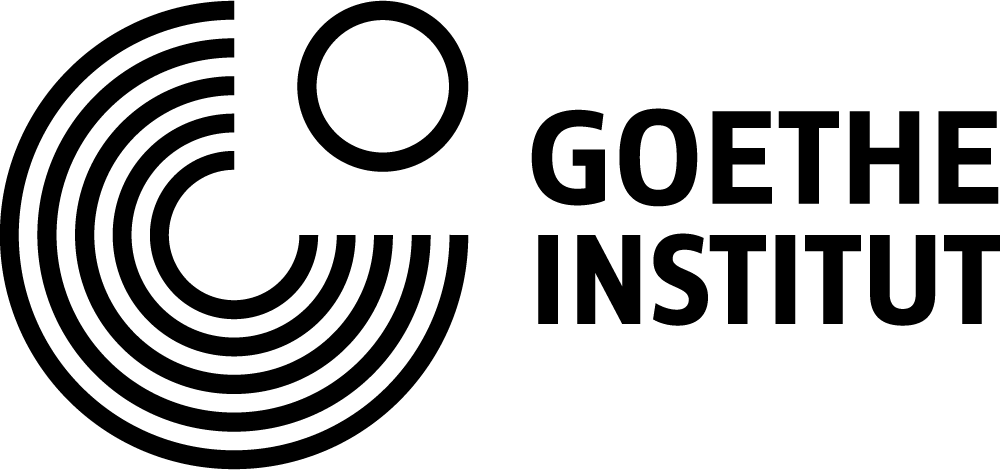
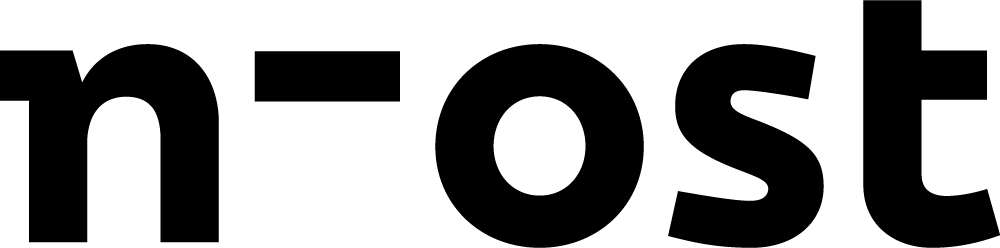
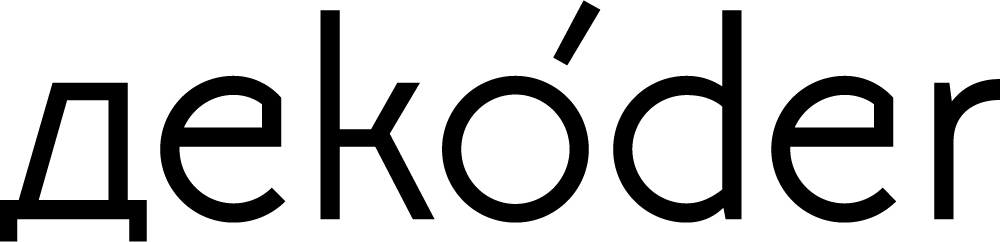






















































Wir danken!
Wunderbar * Danke.
Comments are closed.